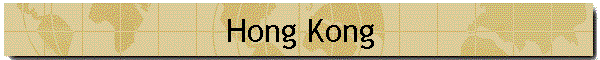
|
|
|
Mail to Webmaster |
Wusstest Du schon,
Nicht? Dann solltest weiterlesen!
Übersetzung: "Viele Liebe Grüsse aus Hong Kong, es ist sehr schön, mir geht es gut, ich komme bald nach hause, 20. Mai 1999, Schändi" (oder so ähnlich...)
Vor wenigen Tagen bin ich aus Vietnam nach China eingereist. Ich schlage mich mit den zwar nett anzusehenden und kunstvollen Schriftzeichen herum und komme mir vor wie der letzte Idiot und Analphabet. Vier der ganz simplen meine ich aus dem Gewirr von Strichen bereits wieder erkennen zu können, aber sicher ist das keineswegs, es könnten ebenso gut andere, ähnlich aussehende sein, die etwas ganz anderes bedeuten. Wenn ich in diesem rasanten Tempo weitermache, werde ich in etwa zehn Jahren in der Lage sein, eine chinesische Zeitung zu lesen. Es ist eine Weile her, seit ich eine anständige Zeitung in den Händen hielt. Über die jüngsten weltpolitischen Ereignisse bin ich daher nur ungenügend informiert, die Entwicklung des Konflikts im Balkan kenne ich nur aus Gerüchten. Für mich wurde der Zeitpunkt etwas ungünstig gewählt, den Drachen anzustacheln. Die Chinesen sind davon überzeugt, dass ihre Botschaft in Belgrad aus böser Absicht bombardiert wurde. In Peking kam es offenbar zu Übergriffen auf langnasige Touristen. Die chinesische Botschaft in Hanoi hängte Warnungen aus und riet vor allem amerikanischen Staatsbürgern von einem Besuch der Volksrepublik ab. Beim Grenzübergang war von der prekären Situation jedoch nichts zu spüren. Keiner der Zollbeamten liess eine Bemerkung fallen. Ich wurde ebenso freundlich und problemlos eingelassen wie der Amerikaner, den ich später am Bahnhof des Grenzortes traf. Bislang zeugte nur ein kleinerer Zwischenfall davon, dass an der aggressiven Einstellung gegenüber Ausländern etwas Wahres dran ist: Ein älterer Mann hielt mir einen längeren Vortrag, von dem ich nur "Clinton" und "Bum-bum" verstand. Seinen Monolog schloss er mit einer eindeutigen Bewegung der Finger am Auslöser einer imaginären Pistole. Schliesslich lachte er, und sowohl die Umstehenden als auch ich stimmten erleichtert ein. Ich erarbeite mir zur Zeit das nötige Vokabular, um mit noch nie zuvor dagewesenem Nationalstolz die helvetische Neutralität zu preisen und halte eine Schweizer Flagge griffbereit im Handgepäck, sollte sich die Lage zuspitzen. Damit rechne ich hier in der bergigen Yunnan-Provinz ganz im Süden Chinas nicht wirklich. Die Leute sind überaus zuvorkommend und hilfsbereit, stammen mehrheitlich von ethnischen Minderheiten ab, Mandarin ist für sie ebenso eine Fremdsprache und Peking liegt weit weg. Mit erhöhter Spannung ist jedoch alleweil zu rechnen. Zu allem Unheil nähert sich der zehnte Jahrestag des Tiananmen-Massakers. Polizeikontrollen und Armeepräsenz werden überall verstärkt. Eine ordentliche Militärparade mit allem Drum und Dran gab es zu meinem Erstaunen in Vietnam keine. Stell Dir vor, es ist 1. Mai und keiner geht hin! Da befindet man sich rechtzeitig zur Feier in einem kommunistischen Land, und es ist überhaupt nichts los. So sehr ich in den Strassen Saigons auch suchte, ich fand keinen Hinweis auf Festivitäten irgendwelcher Art. Geschäfte waren nur wenige geschlossen. Von jubelnden Menschen, landesweiten Festen und Spezialanlässen war lediglich zu lesen. Die einzige englische Zeitung brachte einen längeren Rückblick aus verschiedenen Landesteilen und berichtete ausführlich. Der Schönheitsfehler dabei war, dass ich diese auf den 2. Mai datierte Ausgabe am Morgen des 1. Mai gekauft habe! Es gibt offenbar keine Grenzen, für wie dumm man das eigene Volk verkaufen will. Ebenso ereignislos und ohne ein Zeichen von ausgelassener Freude verlief am Tag zuvor der Liberation Day, der an den Einmarsch des Vietcong vom 30. April 1975 in das sogleich in Ho Chi Minh City umgetaufte Saigon erinnert (die Südvietnamesen halten jedoch hartnäckig am alten Namen fest, wenn sie von ihrer ehemaligen Hauptstadt sprechen). An einen Feiertag erinnerten lediglich die unzähligen Nationalflaggen an den Häuserfronten. An diesem drückend heissen Tag zeigten sich selbst die Fahnen lustlos, der gelbe Stern auf rotem Grund hing schlapp vor den Fenstern. Der zur Schau gestellt Patriotismus ist keineswegs freiwillig, sondern staatlich verordnet, im Unterlassungsfall drohen saftige Geldstrafen. Diese konnte sich der Geschäftsmann, der sich neben mir an der Bar allmählich betrank, offenbar leisten. Er habe dieses Jahr zum ersten Mal die Nationalflagge nicht heraus gehängt, diesen Gugus aus Hanoi mache er nicht mehr mit. Statt dessen hisste er eine Bierfahne. bis hier.Viele der Südvietnamesen fragen sich wohl zu recht, wovon sie denn eigentlich befreit worden sind. Das Joch der Marktwirtschaft kann es jedenfalls nicht gewesen sein. Der Kapitalismus zeigt sich von seiner unerbittlichsten Seite und bettet nur wenige mit harten Dollars weich, alle anderen schlafen auf der Strasse oder in behelfsmässigen Behausungen. Dennoch ist der Lebensstandard im Vergleich zum Norden allgemein etwas höher. Immerhin ist es erstaunlich, wie viele Leute sich angesichts der beschränkten Einkommensmöglichkeiten und tiefen Löhnen ein Motorrad oder gar ein Auto leisten können, für die dieselben Preisen bezahlt werden müssen wie bei uns. Das Verkehrsaufkommen in Saigon ist beachtlich, Tausende von Kleinmotorrrädern schwirren wie ein ungeordneter Schwarm Insekten kreuz und quer. Am Strassenrand zwecks Überqueren auf eine Lücke im Verkehrsstrom zu warten, ist sinnlos. Die einheimischen Fussgänger werfen sich bedenkenlos in das Chaos und plaudern munter miteinander weiter, ohne stehenzubleiben oder die um sie herum kurvenden Fahrzeuge zu beachten. Es ihnen gleichzutun, hat mich anfangs etwas Überwindung gekostet, aber mit der Zeit fand ich Gefallen an meiner Unverwundbarkeit und fühlte mich wie der Held aus einem Action-Film, der einer Maschinengewehrsalve ausgesetzt ist und auf wundersame Weise nie getroffen wird. Entgegen allen Gerüchten bin ich die fast 2'000 km bis Hanoi nicht dem Ho Chi Minh Pfad entlang getrampt, sondern habe den Bus genommen. Die Reise war jedoch beschwerlich. Ich kam mir vor wie Alice im Wunderland, die das falsche Stück Kuchen ass und plötzlich unheimlich anwuchs, nirgends mehr durch- und hineinpasste, weil alles zu klein, zu niedrig und zu eng ist. In den chronisch überfüllten Bussen war ich zwar nicht die einzige, die für Stunden ohne Bewegungsfreiheit eingeklemmt war. Dafür war ich die einzige, die fünf Minuten nach Abfahrt noch wach war und für den Rest der Reise die Einheimischen um ihre Fähigkeit benied, in jeder noch so unmöglichen Stellung zu dösen. Mir schlafen jeweils höchstens die Beine ein. Die anderen Passagiere werden dagegen auf den holprigen Strassen zu echten Headbangern, deren Kopf unkontrolliert vor und zurück geschleudert wird. Abgesehen von wenigen eintägigen Aufenthalten in einem für die Touristen aufgemotzten Badeort mit zweifellos schönem Sandstrand, einem malerischen Küstenstädtchen und ein paar ärmlichen Dörfern im bergigen Hinterland war ich permanent in Bewegung und sah Vietnam lediglich am Bus- oder Zugfenster vorbei ziehen. Fast alle Protagonisten dieses Films tragen den typischen kegelförmigen Strohhut, sei es der Bauer, der seine vor den Pflug gespannten Ochsen über den Acker treibt, das Heer von tief gebückten Gestalten, die auf den Reisfeldern knietief im Wasser stehen, der Entenzüchter, der seine schnatternde Brut über die Strasse lotst oder die vielen Velofahrer, die in Körben Obst, Gemüse und lebendes Geflügel transportieren. In den Marktorten herrscht den ganzen Tag eine rege Geschäftigkeit, es wird Ethno-Kino live geboten. Zwischen unzähligen Marktständen schiebt sich ein endloser Menschenstrom hindurch; ein Mann versucht erfolglos, sich mit seinem Handkarren eine Weg durch das Gewühl zu bahnen; ambulante Händler balancieren über der Schulter zwei an den Enden einer langen Stange festgebundene Körbe voller Waren; eine Frau weint ihren Bananen nach, die soeben von der Polizei konfisziert und zusammen mit dem Tragsystem hinten auf einen Kleinlastwagen geworfen wurden, während sich die anderen Händler ohne Lizenz diesen Schauprozess zu Nutze machten und schnell in einer Seitengasse entschwanden. In den kleineren Bergdörfern sind tagsüber oft nur Heerscharen von Kindern anzutreffen, die neugierig zusammen strömen. Einige tragen ihre jüngeren Geschwister auf dem Rücken, viele haben Rotznasen und sind schmutzig, unter der spärlichen Bekleidung zeichnen sich geschwollene Bäuche ab. Zweimal wollte mir eine Mutter ihr Baby schenken, damit ich es mit in die Schweiz nehme. Die eine Frau hat immerhin zuerst gefragt und meinen negativen Bescheid akzeptiert, die andere drückte mir das Kind schlicht und einfach in den Arm und ging von dannen. Ich musste ihr das unpassende Souvenir quasi gewaltsam retournieren. In Hanoi bin ich auf den Hund gekommen. An einem Imbissstand in einer Seitenstrasse wurde er mit einer scharfen Sauce und dem Reis, der immer klebt, serviert. Von einem Stammbaum wusste die Inhaberin des Lokals nichts, vermutlich war es ein ganz unedler Strassenköter, dessen mit Haut und Haaren ausgekochter Schädel in der Auslage gefährlich die Zähne zeigte. Geschmeckt hat es, wie Fleisch eben so schmeckt, ohne Gewürz und Sauce nicht speziell gut. Aber es ist ja in diesen Ländern oft so, dass man nicht das erhält, was man bestellt hat. Möglicherweise wurde mir gar Schwein oder Rind untergejubelt und der Hund nur verrechnet. Ein Fest besonderer Art war der Grenzübertritt von Thailand nach Kambodscha. Während auf der Thai Seite die buddhistische Neujahrsfeier ausklang und alle mit der üblichen Disziplin ihre Arbeit wieder aufgenommen hatten, war die Party auf der Khmer Seite noch in vollem Gange. Der Grenzbetrieb funktionierte gerade so knapp, die Zollbeamten waren merklich reduziert vom Alkohol, den sie bereits um 9 Uhr morgens intus hatten. Die Jungs von der Quarantäne bestanden darauf, dass ich mein System mit Bier und Reiswein desinfiziere. Fast zwei Stunden sass ich dort fest, bis sie mich endlich gehen liessen. Die Beamten bei der Passkontrolle waren glücklicherweise etwas weniger grosszügig und beeilten sich, um ungestört weiter feiern zu können. Bei der Gepäckkontrolle war gar niemand anwesend. Welcome to the Wild Wild East, das Land der Gesetzlosen und der absoluten Anarchie! Die Naturstrasse von der Grenze bis Angkor Nat ist die übelste in ganz Asien. Krater aus Granateinschlägen jeglicher Grösse machen das Gelände fast unbefahrbar, was unsern Chauffeur nur wenig beeindruckte. Zusammengepfercht mit Mensch und Tier sass in hinten auf der Ladefläche eines Toyota Pick-ups, ich konnte mich nirgendwo festhalten und wurde gnadenlos herum geschleudert. Später stellte ich fest, dass ich überall blaue Flecken abbekommen hatte. Es grenzt an ein Wunder, dass auf dieser Ralley des Wahnsinns niemand abgeworfen wurde. Ob die Lebenserwartung eines Autos oder die eines Passagiers auf dieser Strecke grösser ist, kann ich nicht schlüssig beurteilen. Aber ich kann diese Fahrt all denjenigen empfehlen, denen Zug-Surfen nicht mehr den richtigen Kick gibt. Ich begann, Thailand bereits zu vermissen. Dort gab es an den Transportmitteln jeweils kleine Hinweisschilder, die besagten, dass der Fahrer dieses Fahrzeuges eine dafür notwendige Ausbildung hat und sich für diesen Job qualifiziert. In Kambodscha ist ein Kleinmotorrad mindestens ein Dreiplätzer, kann aber auch eine Grossfamilie transportieren, wie ich einmal beobachten konnte. Der Vater lenkte, die Mutter hielt das Jüngste im Arm und zum Schutz ihres Teints einen Sonnenschirm in der freien Hand, zwischen ihnen eingeklemmt sassen zwei Kleinkinder und ein weiteres klammerte sich hinten an der Mutter fest. Angkor Nat, die Tempelstadt im Dschungel, war imposant. Das Gelände ist riesig, man bräuchte Wochen, um alles zu sehen. Ich habe mir nach drei Tagen gesagt, "so Angkor what" und die restlichen Tempel Tempel sein lassen. Bereits in Burma hatte ich nämlich eine Überdosis Buddhas erwischt. Sitzend, stehend, liegend, gigantisch, lebensgross oder en miniatur, aus Stein, aus Marmor vergoldet oder mit Edelsteinen besetzt, Buddha wird erleuchtet, Buddha meditiert oder Buddha predigt, die Variationsmöglichkeiten werden voll ausgeschöpft. Mit seinen vielarmigen und -köpfigen Figuren bot der hinduistische Pantheon mehr Abwechslung, dafür weniger Ästhetik. Interessanterweise tauchen einige Götter aus der Hindu-Saga in Angkor Nat auf und mischen sich unter die Buddhas und Bodhisattras. Das Gebiet um Angkor Nat soll angeblich heute völlig minenfrei sein. Ich wüsste zum Glück nichts Gegenteiliges zu berichten. Schätzungen zufolge sind noch immer doppelt so viele Personenminen im Boden wie es in Kambodscha Einwohner gibt. Vielerorts warnen rote Schilder mit Totenkopf vor Minenfeldern. Die Produktionskosten einer Personenmine dieses Typs, die nicht tötet, sondern einbeinige Sozialfälle schafft, betragen $ 2.--, das Auffinden und Ausgraben kostet dagegen $ 900.-- pro Mine, wie mir ein mit der Entminung beauftragter Spezialist aus Australien erzählte. Trotz verschärften Gesetzen spazieren im ganzen Land nach wie vor zu viele mit einer Waffe herum. Die Lage hätte sich jedoch im Vergleich zu früher wesentlich entschärft, meinte ein Lastwagenfahrer, der mich mitnahm. Er würde längst nicht mehr auf jeder Fahrt zum Anhalten gezwungen und man könne sich heute nach kurzen Verhandlungen auf einen vernünftigen Geldbetrag einigen. Wer nachts herumfahre, sei selber schuld. Die Khmer Rouge sind zerschlagen und nur noch vereinzelt anzutreffen, vor allem im Westen des Landes stellen sie sich an Brücken auf und verlangen Wegzoll, der von den Fahrern jeweils ohne Widerspruch entrichtet wird. An das Terrorregime der Khmer Rouge erinnern die Killing Fields ausserhalb von Phnom Penh, die zur Touristenattraktion Nummer 1 hoch stilisiert werden. Inmitten der ausgehobenen Wassergräber wurde ein riesiger Glasturm errichtet, in welchem die fein säuberlich auf einander gestellten und nach Alter und Geschlecht geordneten Schädel ausgestellt sind. Über die riesigen Gräber ist inzwischen Gras gewachsen. Farbe in das Grün bringen nur die Stofffetzen und Kleiderreste der Toten, die überall aus dem Boden hervor drücken. Noch schockierendere Bilder sieht man in einem ehemaligen Schulgebäude, das von den Khmer Rouge zu einem politischen Gefängnis umfunktioniert wurde und heute ein Museum ist. Über 17'000 Leute wurden dort zu Tode gefoltert. Genozid ist nichts Neues, neu ist hingegen die Selbstgerechtigkeit der Folterer, alles fotografisch zu dokumentieren und minuziös festzuhalten. Von jedem Gefangenen wurde ein Bild geschossen und mit Namen und Datum versehen. Die Fotogalerie besteht aus verängstigten Gesichtern, zerschlagenen und entstellten Gestalten, verkrümmten Körpern in der eigenen Blutlache, Frauen mit Kleinkindern in den Armen und Gruppenaufnahmen in Massenzellen. Drei Millionen Leute, ein Viertel der damaligen Bevölkerung, kamen während der 4-jährigen Herrschaft der Khmer Rouge ums Leben. Es fällt schwer, sich die Millionenstadt Phnom Penh völlig entvölkert vorzustellen, weil alle Einwohner im Zuge der Umstrukturierung zur glücklichen Agrargesellschaft zur Zwangsarbeit aufs Land getrieben wurden. Zur Notwendigkeit, diese Verbrechen an der eigenen Bevölkerung zu sühnen und den verhafteten Führern der Khmer Rouge den Prozess zu machen, äussert sich der amtierende Premier, Nun Sen, fast täglich. Dass er selbst einmal ein Kopf der Khmer Rouge war, der rechtzeitig in das Lager der Vietnamesen, der Folgemacht nach dem Sturz der Khmer Rouge, gewechselt hat, scheint ihn nicht zu stören. Es sind bekanntlich die Schlimmsten, die am lautesten schreien. Alle anderen sind zwangsläufig etwas ruhiger, weil es um die Meinungsfreiheit nicht zum besten bestellt ist. Ein Journalist musste zwei Monate im Gefängnis absitzen für seine Bemerkung, ein anderer aufstrebender Politiker sei noch blöder als Nun Sen. Politisch korrekt wäre wohl eine Wortwahl wie "weniger intelligent als" oder "nicht annähernd die Spitzenklasse von" gewesen. Nun Sen spielt oder ist tatsächlich der starke Mann, die Opposition ist zersplittert und zerstritten, das Land versinkt dennoch nicht im völligen Chaos, alles funktioniert erstaunlicherweise doch irgendwie. Während man der Prostitution in Thailand leicht ausweichen kann, ist sie in Kambodscha allgegenwärtig. Keine Bar ohne die jungen Freelancer, die leicht geschürzt und kräftig geschminkt wackelig auf hochhackigen Schuhen auf und ab gehen. Ganze Strassenzüge und Quartiere in Phnom Penh bestehen aus Holzbaracken, die als Bordelle dienen. Die Discount-Prostituierten bieten sich für 2 bis 3 $ an. Ein Barbesitzer und Zuhälter schwärmte von den rosigen Zeiten, als die UN Peace Keeping Forces noch im Land waren und das Geschäft zum Blühen brachten - die Erfolgsgeschichte einer UNO-Mission! Es sollte nicht mehr so lange dauern, wie es bereits gedauert hat, bis wir uns wiedersehen, ich bin nur noch ca. 15'000 km von zu Hause entfernt und mit dem Gesicht bereits wieder gegen Westen!
Bis bald Andrea |